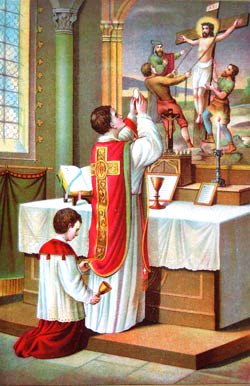|
Der Gottesdienst in der außerordentlichen Form des
römischen Ritus |
|
Ein Gottesdienst in der
außerordentlichen Form des römischem Ritus, was ist
das für
ein Gottesdienst, und was unterscheidet ihn
von dem sog. „ordentlichen Ritus“? Außerordentliche
Form bezeichnet eigentlich die klassische Form der
römischen Liturgie, wie sie nach dem Konzil zu
Trient (1545-1563) geordnet ist. Im Jahre 1570 wurde
durch den hl. Papst Pius V das Messbuch (Missale
Romanum) approbiert. Dieses galt
mit leichten
Änderungen bis 1970. Die letzte Änderung wurde 1962
vorgenommen. Dieses Messbuch ist die Grundlage des
ausserordentlichen Ritus. Der „ordentliche Ritus“
wird „Forma Ordinaria“ genannt. Er wurde von Papst
Paul VI 1970 approbiert.
Dieser wird heute
überwiegend in der römisch-katholischen Kirche
gefeiert.
„In den gottesdienstlichen
Riten finden wir einen authentischen Ausdruck des
ganzen
katholischen Glaubens, der in ihnen Gestalt
geworden ist. Sie sind nicht einfach
‚gemacht’,
sondern aus der lebendigen Tradition seit
urkirchlichen Zeiten organisch gewachsen.“1)
Die Grundstruktur des
Ritus entspricht genau der leib-seelischen Natur des
Menschen. Wären wir reine Geister, also Geistseelen
ohne Leib, bräuchten wir nicht den sichtbaren
Ausdruck. So aber ist es notwendig, dass wir innere
Haltungen in äußeren Formen ausdrücken und dass das
Heilige über die Sinne Zugang zur Seele findet. Dazu
sagt
das Konzil von Trient: „Die
Menschennatur ist so beschaffen, dass sie nicht
leicht
ohne die Beihilfe von außen zur Betrachtung
göttlicher Dinge emporsteigen kann.
So hat die gütige Mutter, die Kirche, bestimmte Formen für den
Gottesdienst
eingeführt, dass nämlich
in der Messe
manches leise, anderes aber mit lauter Stimme
gesprochen werden soll. Ebenso nahm sie
gottesdienstliche Handlungen in Gebrauch,
wie
geheimnisreiche Segnungen, Lichter, Weihrauch,
Gewänder und vieles andere
dergleichen nach
apostolischer Anordnung und Überlieferung. Dadurch
sollte die Hoheit dieses großen Opfers zum
Bewusstsein gebracht und die Herzen der Gläubigen
mittels dieser sichtbaren Zeichen des Gottesdienstes
und der Frömmigkeit zur Betrachtung der erhabenen Dinge, die in diesem Opfer verborgen liegen,
aufgerufen werden.“
1)
Die Sprache des Gottesdienstes
Die lateinische Sprache ist ein besonderes Merkmal
des klassischen römischen Ritus. Vielen Katholiken
ist sie nach dem
II. Vatikanischen Konzil fremd geworden, obwohl
die
Konzilsväter ihren Erhalt ausdrücklich gewünscht
haben.
Dabei fehlt es zumeist am Verständnis für den
tieferen Sinn und den symbolischen Wert dieser
Sprache.
Sollte man
nicht annehmen, dass die Kirche gute Gründe hatte,
jahrhundertelang
daran festzuhalten?
Schließlich hat die lateinische Sprache den großen
Vorzug der Zeitlosigkeit, denn zumindest in ihrem
liturgischen Gebrauch ist sie vollendet und
ausgereift, wohingegen die modernen Sprachen einem
beständigen Wandel
unterliegen. Der Gottesdienst
nach dem Messbuch von 1970 wird überwiegend in den
Landessprachen gehalten, obwohl auch hier die
lateinische Sprache möglich wäre.
- die Vorteile der lateinischen Sprache:
• In ihrer Originalität führt sie direkt zu den
Quellen: Noch heute benutzen wir genau dieselben
Texte, mit denen die ersten römischen Päpste und die
Heiligen aller Jahrhunderte gebetet haben. Wir
singen noch immer dieselben Melodien,
die der
hl. Papst Gregor der Grosse [† 604] gesammelt und
aufgezeichnet hat.
• Aufgrund ihrer Unveränderlichkeit und Präzision
ist die lateinische Sprache bestens geeignet, im
kultischen Vollzug die ewigen und unveränderlichen
Wahrheiten des katholischen Glaubens auszudrücken.
• Sie ist von zeitloser Schönheit und gleicht einer
romanischen Klosteranlage, die in
edler Schlichtheit
dem ästhetischen Empfinden jeder Zeit und aller
Menschen gerecht wird. Ganz anders ist es hingegen
mit gewissen Erzeugnissen einer modernen
Architektur, die man oft schon nach wenigen Jahren
nicht mehr anschauen mag.
Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass es ein
grosses Verdienst der
vorkonziliaren liturgischen
Bewegung war, durch die Verbreitung
lateinisch/deutscher Volksmessbücher den Gläubigen
einen direkten Zugang zu den Reichtümern der
liturgischen Texte zu eröffnen. Wer seinen
Schott
gut zu gebrauchen weiß, dem bleibt die lateinische
Kultsprache nicht fremd. Vielmehr wird gerade sie
ihm helfen, in dieTiefe zu gehen, und gleich dem
Hausvater,
„der aus
seinem Schatz Neues und
Altes hervorholt” (Mt 13,52),
in der Liturgie reichlich Nahrung zu finden für sein
geistliches Leben.“3)
|
Die Gliederung des
Messe im klassischen Ritus
Die klassische Messe ist in drei Hauptteile klar gegliedert.
Dieses Schema wird
Ordo Missae genannt. Es gibt
unveränderliche
und veränderliche Teile im
Ordo Missae.
Ablauf eines
Gottesdienstes:
•
„Asperges“ oder „Vidi aquam“
• Einzug und
Stufengebet mit Sündenbekenntnis
(Confiteor)
•
Introitus,
Kyrie, Gloria
•
Gebet (Oratio)
•
Epistel-Lesung
•
Zwischengesang (Graduale)
•
Evangelium
•
Predigt
•
Glaubensbekenntnis (Credo)
•
Offertorium
mit Gabenbereitung /
Secreta
•
Präfation
/ Sanctus
•
Hochgebet (Canon) mit Wandlung
•
Pater noster
•
Agnus Dei
•
Kommunionempfang (Communio)
•
Schlussgebet (Postcommunio)
•
Segen
•
Schlussevangelium (Joh. 1, 1-14)
• Auszug
Der Ordo Missae ist im Schott-Messbuch enthalten. Er wird
auch durch die Priesterbruderschaft St. Petrus als
kostenlose Broschüre angeboten.
Warum feiert der Priester mit
Blick zum Altar?
Der Priester feiert oder zelebriert versus crucem. Das
bedeutet, Priester und Volk sind gemeinsam zum Kreuz hin
ausgerichtet.
Hinter diesem
uralten Brauch verbirgt sich
eine schöne Symbolik und ein
grosser spiritueller Reichtum von bleibender Bedeutung.
„Die traditionelle Gebetsrichtung ist Ausdruck einer
gewissen Höflichkeit Gott gegenüber. Auch unter Menschen
gehört es sich, dass man den anschaut, mit dem man spricht.
Es ist selbstverständlich, dass der Priester sich zur
Predigt, die an das Volk gerichtet ist, auch zum Volk hin
wendet. Das Gebet aber richtet sich nicht an das Volk,
sondern ist Erhebung der Seele zu Gott. Deshalb scheint es
ebenso selbstverständlich, sich zum Gebet und zum Vollzug
des eucharistischen Opfers auch äusserlich ganz Gott
zuzuwenden. Die gemeinsame Gebetsrichtung von Priester und
Volk ist ein schönes
und starkes Zeichen der Einheit. Es
wäre ein Missverständnis, anzunehmen, Einheit
sei nur dort,
wo man einander anschaut. Eine viel stärkere Einheit
entsteht, wenn man
ein gemeinsames Ziel vor Augen hat und in
eine Richtung schaut. Es geht ja in der
Messe gar nicht
darum, dem Priester zuzuschauen und noch viel weniger, ihn
anzuschauen, sondern der Priester gleicht dem Hirten, der
seiner Herde vorangeht
dem Herrn entgegen. Es ist bedeutsam,
dass man gerade im Moment der Wandlung
das Gesicht des
Priesters nicht sieht. So wird der objektive Charakter der
Liturgie betont, denn der Priester am Altar handelt in
persona Christi. Er ist nur Stellvertreter, denn der einzige
und eigentliche Priester des Neuen Bundes ist Christus
selbst. Für die Gläubigen wird es so viel leichter, von der
Person des zelebrierenden Priesters abzusehen, um
zum ewigen
Hohenpriester aufzusehen.“4)
So ist die Behauptung „Der Priester zeigt dem Volk seinen
Rücken.“ ungenau und falsch. Auch in der Messe nach dem
Messbuch von 1970 ist es möglich versus crucem zu
zelebrieren. Leider geschieht das so gut wie nie.
Norbert Koenig
|
Hier finden
Sie den Artikel im pdf Format zum Ausdrucken |
| |
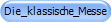 |
|
1) „zum Altare
Gottes will ich treten“
P. Martin Ramm FSSP
2)
Konzil von Trient, 22. Sitzung
[1562], 5. Kapitel
3) siehe Nr. 1
4) siehe Nr. 1
Über die Liturgie können Sie sich auf
Alte Messe
ausführlich informieren.
Jeder, der zum ersten Mal eine hl. Messe im klassischen
römischen Ritus erlebt, wird
viel Neues entdecken. Wenn er
sich ohne Vorbehalte ganz auf diese Messe einlässt,
kann er einen wundervollen Schatz finden. Nachfolgender Text
gibt jeden eine kleine Orientierungshilfe zur Mitfeier der
hl. Messe im klassischen röm. Ritus. Ein herzliches
vergelt´s Gott an Pater Martin Ramm FSSP, der uns die
Veröffentlichung dieses
Textes erlaubte.
Wie beschrieben ist die Messe im klassischen Ritus klar
gegliedert. Dieses Schema wird "Ordo Missae" genannt.
Nachfolgend finden Sie ein "Ordo Missae" Diesen können Sie
sich runterladen und ausdrucken. Er ist zum Verständnis und
zum Mitvollzug der
hl. Messe sehr wichtig. Sie finden ihn in
deutscher und lateinischer Sprache.
|
|
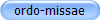 |
|
Ein herzliches vergelt´s Gott an die
Priesterbruderschaft St. Pius X, die uns den Text
zur Verfügung stellte.
|
|
Unser Priester, Pater Alanus O.P. feiert jeden
ersten Sonntag im Monat eine
hl. Messe im
dominikanischen Ritus. Diese Liturgie unterscheidet
sich in einigen
Punkten vom römischen Ritus. Herr Serwe hat ein Ordo Missae für unsere Webseite
bearbeitet. Sie finden ihn hier zum Ausdrucken im
pdf.Format
Dieses lateinisch - deutsche Ordo Missæ soll
helfen, den Reichtum der heiligen
Messe nach dem
Ritus der Domininkaner einem jeden zu
erschließen.
Es ist v. a. für den Gebrauch
während der heiligen Messe gedacht.
|
Grundlage für die Messe ist das Missale Romanum von
1962, welches auf das
Missale des hl. Papstes Pius
V. von 1570 zurückgeht. Die Abtei Mariawald hat das
Missale ins Internet gestellt.
|
|
Das Ordo Missae können Sie auch an dieser Stelle
als Datei laden. Dieses enthält zusätzlich auch die
wichtigsten Grundgebete der Kirche. Ein herzlichen
Dank an die Priesterbruderschaft St. Petrus. |
|
Hier können Sie ein Video sehen in welchem die
hl. Messe ausführlich erklärt wird.
Es dient zur Weiterbildung von Priestern. Aber
auch für jeden anderen ist es
interessant. Das Video hat eine Laufzeit von
knapp einer Stunde.
|
Papst Gregor der Große (um 540 - 604) Papst von 590 bis 604,
war einer der bedeutendsten Päpste seiner Zeit. Die
Gregorianischen Choräle in der Liturgie unserer Kirche sind
vor allem auf sein Wirken zurückzuführen. Sie sind zum Teil
wesentlich älter, werden aber mit dem Namen "Gregorianischer
Choral" bezeichnet. Sicher ist, dass schon Papst Gregor
diese in der Liturgie gehört hat.
Als Gregorianischer Choral wird gemeinhin der einstimmige
und unbegleitete Gesang der römisch-katholischen Liturgie
bezeichnet. Sie ist eine seit der Antike überlieferte
Gesangstradition, welche bis heute in der
römisch-katholischen Kirche gepflegt wird. Im Gegensatz zu
den Kirchenliedern in der jeweiligen Landessprache lässt
sich der Gregorianische Choral als objektiver Gesang der
Liturgie bezeichnen.
|
|

|
|
|
|
Papst Gregor der Große 590 - 604 |
|